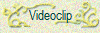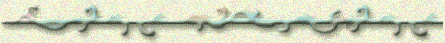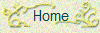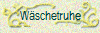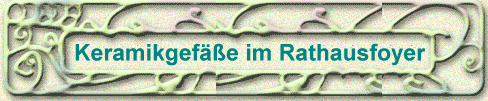
Im Rathausfoyer wurden von der Vorsitzenden des Heimat- und Museumsvereins, Ute Ansahl-Reissig, und Waltraud Sandner zwei Ausstellungsvitrinen mit Steingut-Gefäßen bestückt, die sich im Fundus des Museums befanden. Die unterschiedlichsten Gefäße stammen aus der Zeit des 20. Jahrhunderts.
Steingut wurde im 18. Jahrhundert in England erfunden und besteht in der Regel aus Ton, Quarz, Feldspat und ggf. anderen Mineralien wie zum Beispiel Calcit. Die Produkte werden üblicherweise im Gießverfahren ausgeformt. Die Brenntemperatur ist mit 970–1320 °C niedriger als bei Sinterzeug. Aufgrund der geringen Brenntemperatur kann das Material nicht vollständig versintern und wird somit im Gegensatz zu Steinzeug nicht wasserdicht. Deswegen wird Steingut meist mit einer allseitig aufgetragenen Glasur versehen. Sie ist durchsichtig, oft bleihaltig, und wird in einem zweiten Brand aufgeschmolzen. Die Bemalung bzw. der Dekor werden vor dem Glasurbrand aufgetragen.

Tontöpfe aus Westerwälder Steingut
mit Salzglasur
Steingut erfreut sich bis heute nicht nur wegen der kostengünstigen Herstellung, sondern auch seiner dem Porzellan ähnlichen Gebrauchseigenschaften, großer Nachfrage und Beliebtheit. Steingut ist allerdings stoßempfindlicher als Porzellan und nicht so reinweiß. Noch deutlicher unterscheidet es sich vom Steinzeug, mit dem es wegen des Wortlauts sehr häufig sprachlich verwechselt wird. Doch sind die materiellen Unterschiede deutlich: Steinzeug gehört zur Klasse Sinterzeug, es ist wasserundurchlässig, hat einen dunkleren, härteren (hell klingenden) Scherben und ist selten so glatt und dünn glasiert wie Steingut. Nur bei Erzeugnissen aus jüngerer Zeit gibt es durch ähnliche Dekore und gleiche Glasurtechniken Abgrenzungsprobleme zum Feinsteinzeug.
Hauptanwendungsgebiet des Steinguts ist seit Beginn das Tafelgeschirr. Im 19. Jahrhundert kamen Haushaltswaren hinzu: die unverzichtbaren Waschgeschirre und alle Arten von Vorratsbehälter. Spezialisierte Hersteller fertigen seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert auch Wandfliesen und Dekorationselemente aus diesem Material.
Einer der führenden Anbieter von anspruchsvoll gestaltetem Gebrauchsgerät aus Steinzeug in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts war die Wächtersbacher Keramik. Ende des 18. Jahrhundert gab es schon an die 100 Steingutmanufakturen in Deutschland, die bekanntesten hiervon in Amberg und Bayreuth, Ansbach, Mettlach, Saargemünd.